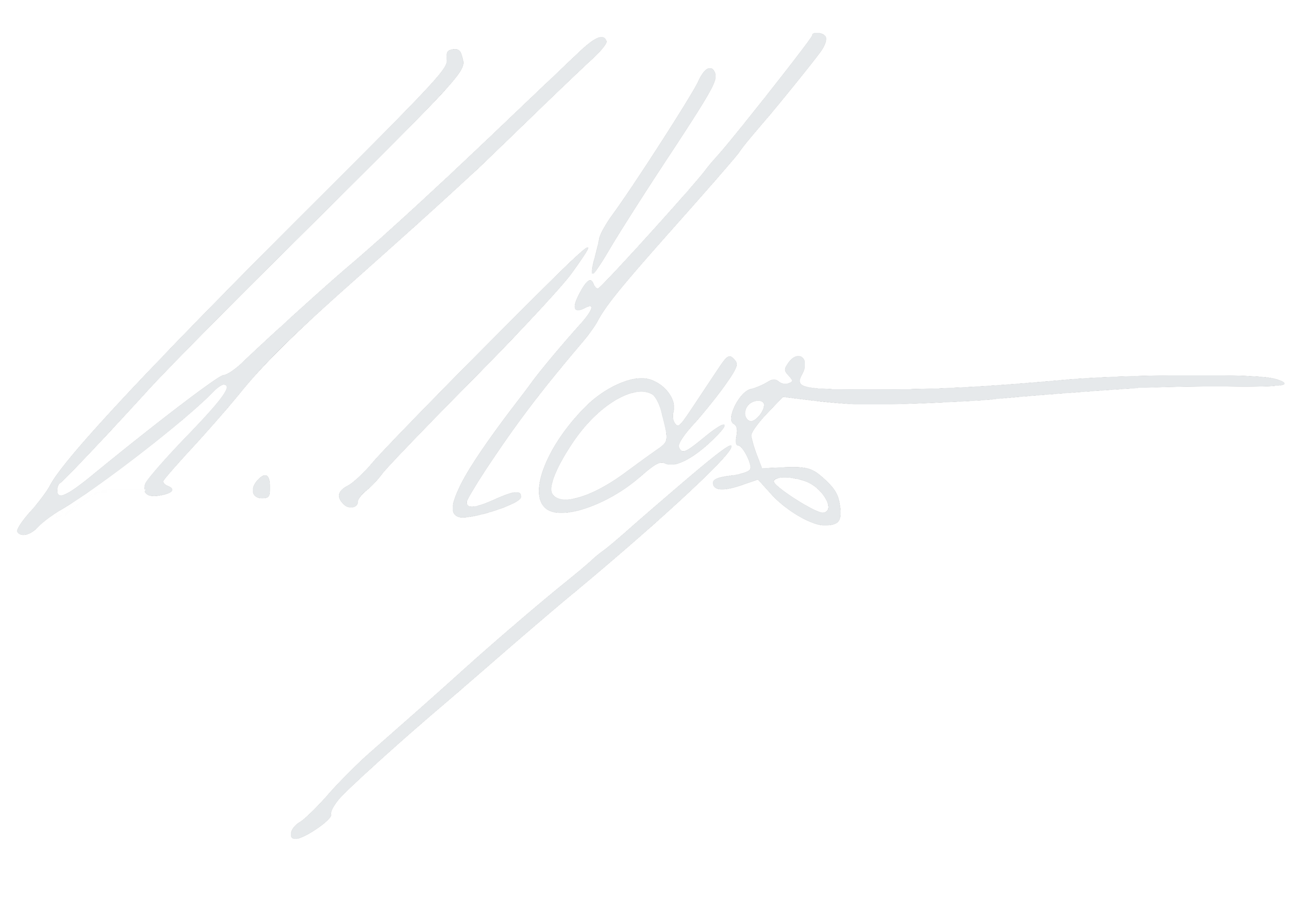„Jeder Mensch sollte die gleichen Chancen haben. Das erachte ich als ein Grundrecht. Doch leider ist dies nicht jedem gewährt, was sich dringend ändern muss. Deshalb bitte ich Sie, Señor Presidente, nun endlich entsprechend zu agieren! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“
Er nahm - immer noch leicht zitternd - sein Skript vom Rednerpult und ging zurück auf seinen Platz im demokratischen Flügel des venezolanischen Parlaments. Seine Nachbarin beglückwünschte ihn für die gelungene Rede, doch er war noch zu aufgeregt, um dieses Kompliment zu entgegenzunehmen. Das war es also gewesen: Die erste Rede vor dem Parlament. „Das ging ja besser als erwartet!“ Auch wenn er noch überlegte, was er alles für Fehler gemacht hatte und ob diese vielleicht irgendwer bemerkt hatte, war er doch sehr zufrieden mit sich. Doch die größte Probe stand ihm heute noch bevor: Der Besuch des Slums heute Nachmittag.
Er hatte schon ganz weiche Knie, als die Limousine vorfuhr. Der Chauffeur kam auf ihn zu, als er das Haus verließ. Er öffnete ihm die Wagentür und sie fuhren los. Umso näher sie dem Ziel kamen, desto aufgeregter wurde er. Die verzweifelten Versuche, sich zu beruhigen, blieben leider ohne jeglichen Erfolg.
Das Auto kam unmittelbar hinter der extra für seine Rede aufgebauten Freilichtbühne zum Stehen. Er stieg aus und ging mit zitternden Knien die Stufen zur Bühne hoch. Etwa mittig stand das Rednerpult. Er legte sein Skript darauf ab und schaute in das Publikum. Auf dem kompletten Platz standen Leute unterschiedlichsten Alters, oft mit schäbigen Klamotten, dicht gedrängt zwischen den heruntergekommenen Häusern. Sogar ein Fernsehteam war gekommen, was eine kleine Panikattacke bei ihm auslöste, doch er schaffte es, diese unter Kontrolle zu bringen.
Er räusperte sich und begann mit seiner Rede. Es war fast die gleiche, die er heute morgen schon vor dem Parlament gehalten hatte. Sie war nur etwas umformuliert: Er versprach zum Beispiel mehrmals eine Verbesserung der Wohnverhältnisse in Vororten wie diesem oder ein höheres Arbeitslosengeld.
Auch diese Rede lief besser als erwartet. Der tosende Beifall und Jubel am Ende der Rede bewies ihm, dass sein Vortrag offensichtlich genau den richtigen Nerv bei den Bewohnern des Ghettos getroffen hatte. Er war sichtlich erleichtert, dass bisher alles so glatt verlaufen ist. Er verließ die Bühne wieder über denselben Weg, den er auch hochgegangen war. Nachdem er dem Chauffeur sein Skript gegeben hatte, fragte er einen seiner Leibwächter, was denn als Nächstes auf dem Programm stehe. „Die Besichtigung der Wohnung!“
Ziel war einen großen Wohnblock. Seine Bodyguards und er gingen über die Treppe in den sechsten Stock. Das alles war ganz präzise geplant, weshalb sie auch schon von der alleinerziehenden Mutter und ihren vier Kindern erwartet wurden. Er betrat das Apartment, ein Leibwächter folgte ihm.
Schon als er zur Haustür hereinkam, schlug ihm ein sehr unangenehmer, nicht genau definierbarer Geruch entgegen, doch er wollte nicht unhöflich sein und versuchte deshalb, sich nichts anmerken zu lassen. Ein sehr altes, grau-gelbes Klappsofa nahm fast das gesamte Wohnzimmer ein. „Sicher war es einmal weiß gewesen“ dachte er sich. Davon gegenüber stand eine stark beschädigte Wohnwand mit einer Art Laminat in Holzoptik, welches sich allerdings schon von den Spanplatten löste, worauf ein schwarzer Röhrenfernseher, ein alter Kassettenspieler mit Radiofunktion, wie auch einige Kassetten und sonst allerlei Trödel standen. Gleich daneben war ein Türrahmen ohne Tür zur Küche. Eine Küchenzeile aus den 1970ern, sowie ein relativ neu wirkender, aber einfacher Tisch befanden sich dort. Um letzteren waren unterschiedliche, zusammengewürfelte Stühle herumgruppiert. Zu guter Letzt besichtigte er die beiden Schlafzimmer. Beide waren karg möbliert; jeweils mit einem Stockbett, einem normalen Bett und zwei großen Schränken. Zur Besichtigung des Bades kam es glücklicherweise nicht mehr - die Zeit war um und sie mussten weiter. Er verabschiedete sich und ging.
Er war gerade wieder auf die Hauptstraße zurückgekehrt, als plötzlich ein Schuss fiel. Die Menschen, die sich am Straßenrand versammelt hatten, rannten kreischend in ihre Häuser. Seine Leibwächter zogen ihre Waffen und prüften mit vorgehaltener Pistole die Umgebung. Die Bodyguards waren gerade dabei, die Schießeisen wieder einzuschieben, als erneut ganz in der Nähe eine Pistole knallte. Um ihn in Sicherheit zu bringen, wurde er von einem der Gardisten am Oberarm gepackt und in einen kleinen Schuppen am Ende der Gasse gestoßen. Er warnte ihn noch schnell, sich ruhig zu verhalten, bevor der Wachmann den Verschlag verließ. Er saß im Dunkeln. Verzweifelt suchte er nach einem Lichtschalter. Als er ihn gefunden hatte und sich im Raum umsah, traute er seinen Augen nicht: Das würde ihn zum Helden werden lassen.
Zwei Tage später stand er also erneut im selben Vorort auf derselben Bühne am selben Rednerpult. Doch diesmal hatte er kein Skript bei sich, sondern äußerte sich nur kurz zu den Geschehnissen: „Ich denke, dass Carlos Pedrez nicht versehentlich von der Kugel getroffen wurde, sondern dass er vorsätzlich erschossen wurde! Ich denke, dass er die hier vorherrschende Drogendealerbande an die Polizei verraten wollte, um diesen Vorort nicht länger von ihnen tyrannisiert sehen zu müssen. Dank meiner Mithilfe konnte die Behörden massenhaft Rauschmittel beschlagnahmen. Ich denke, der Verlust der Ware wird die Bande in den Ruin treiben und es wird für die Polizei ein Leichtes sein, die Verbrecher zu stellen.“
Er erntete bei weitem nicht so viel Applaus wie das letzte Mal, stattdessen fingen die Leute an, heftig zu diskutieren und unzählige Fragen zu stellen. Manche kletterten zu ihm auf die Bühne, um ihn mit Fragen zu bombardieren. Er drängelte sich an ihnen vorbei und verließ die Versammlung. Gerade nachdem er die letzte Stufe heruntergegangen war, ratterte ein automatische Waffe. Die Leute stoben in Panik auseinander.
Er bekam Angst und floh in die Sicherheit seiner schwarzen Limousine. Wo war sein Chauffeur? Auch seine beiden Bodyguards waren nicht zu sehen. Da öffnete sich die Autotür und zwei vermumte junge Männer mit Lederjacke, Halskette, Sonnenbrille sprangen auf die Vordersitze. Einer fuhr rasend los, der andere bedrohten ihn mit einer Pistole.
Er schrie so laut wie möglich, er zerrte an dem Türschloss, um aus dem Wagen zu springen - doch vergebens. Er hatte schon einen ganz trockenen Mund, weiche Knie und schlecht war ihm auch. Was hatten die mit ihm nur vor?
Das Auto kam im Hinterhof eines alten, leerstehenden Fabrikgebäudes zum Stehen. Er wurde aus dem Wagen herausgestoßen. Der Fahrer ging voraus und öffnete mit einem kräftigen Tritt gegen die große Metalltür, welche aufschwang und mit laut gegen die Wand donnerte, sodass es im Gebäude nachhallte. Der zweite stieß ihm mit seiner Knarre in das Treppenhaus, das sich vor ihnen so abrupt eröffnet hatte. Seine Entführer zwangen ihn gewaltvoll die Treppen nach oben. Immer wieder stolperte er, was seinen Anzug und seine Knie zerschliss. Sie zerrten ihn immer wieder gewalttätig auf seine Beine und schoben ihn weiter nach oben. Als sie endlich im vierten Stock angekommen waren, war sein ganzer Körper bedeckt mit seinem Schweiß, Tränen und Blut.
Nach einer weiteren Türe eröffnete sich vor ihm eine große, aber nicht besonders hohe leere Fabrikhalle, welche lediglich durch ein paar ferne, verschmutzte Fenster spärlich beleuchtet wurde.
Die anderen Bandenmitgliedern erwarteten ihn bereits. Sie traten zur Seite und gaben den Blick auf einen Tisch mit einem alten, vergilbten Computer frei, der sich deplatziert in der Mitte des Raumes befand. Am dazu passenden Schreibtischstuhl saß bereits der Kopf der Verbrecherbande: „Der muss der Chef sein“, huschte ihm noch durch den Kopf. Die anderen gruppierten sich um den Stuhl herum. Doch anstatt dass diese in seine Richtung sahen, kehrten sie ihm den Rücken. Und als wäre das nicht schon wunderlich genug, legte der Fahrer, der sich noch bei ihm befunden hatte, einen Lichtschalter um: Das blaue Licht der Leuchtstoffröhren ließ seine Haut orange-rot erscheinen. Nun stellte auch er sich zu den anderen, mit dem Rücken zu ihm.
Er schwitzte und zitterte am ganzen Körper. Was hatten diese Gangster bloß mit ihm vor? Und außerdem - wo blieb denn die Polizei? Irgendjemand musste ihm doch helfen können! Er konnte kaum mehr einen klaren Gedanken mehr fassen. Die Schmerzen und schiere Überlebensangst übernahmen die Kontrolle über seinen Körper.
Der andere der beiden Entführer hatte ihm bislang immer noch die Pistole in den Rücken gehalten. Nun lief er langsam um ihn herum, die Waffe immer noch auf ihn gerichtet. Als er vor ihm stand, hob er die Knarre langsam an und zielte direkt auf seine Stirn.
Hasserfüllt, aber langsam und verhalten gab er von sich: „Dafür, dass du uns an die Polizei verraten hast!“ Er spuckte ihm vor die Füße und drückte sofort danach ab.
Noch bevor das Blut aus der Kopfwunde des Opfers quoll, schob der Täter den leblosen Körper auf den Tisch und tippte in den Computer: „Denken ist ungesund“.